
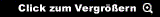
|
Tulear –
in
den Ruinen der Modernität
Beinahe
im Expresstempo kommen wir von Ranohira nach
Tulear. Anders als sonst, nämlich anstatt stundenlangen
Wartens, erreichen wir diesmal mit Glück einen Bus, auf
den wir nur fünf Minuten warten brauchen und der uns
dann tatsächlich in die ferne Hafenstadt fährt.
Die
letzte Etappe der über 1000 Kilometer langen „Route
du Sud“ führt uns entlang des Isalo-Gebirges,
dessen Ausläufer nun nicht mehr Grasland sind,
sondern ein ganz und gar ausgebranntes, ödes Land mit
Sand, wo – bizarr anzusehen – einzelne Palmen
(Bismarckia nobilis) gediehen. Wüstenhaft war dann die
Landschaft um Sakaraha, wo wir zur Mittagszeit haltmachen
und zum
ersten Mal die am Straßenrand gegrillten Fleischspieße
versuchten. Lohnend. Dann geht es weiter durch das Dornenland
des Südens. Hier ist es doch schade, dass wir nur
mit dem Bus durchbrausen und nicht halt für das eine
oder andere Foto machen können. Zum einen sind da die weißen,
rechteckig angeordneten Friedhöfe der Antandroy mit
ihrer bunten Wandbemalung, welche eine nähere Betrachtung
verdient hätten, zum anderen die mächtigen, widerstandsfähigen
Baobabs, die der Landschaft, weithin sichtbar, Charakter
geben.
Tulear
bringt erst einmal Ernüchterung.
Bei einem ersten Spaziergang traue ich meinen Augen nicht,
der Strand,
den ich beim Hotel Plazza vorfind, ist eine einzige Kloake,
wo Schweine sich fressend über den herumliegenden Müll
hermachen, daneben Marschland, und dahinter das Meer, zwar
kraftvoll mit den niedrigen,
starken
Wellen
der
beginnenden
Flut, aber
dunkel, fast schwarz, in keinem Fall einladend.
Ich
wende mich schnell ab und spaziere eine Weile auf einer
mit Palmen gesäumten Strandpromenade, die fast
menschenleer ist und wohl schon bessere Zeiten gesehen
hat. Der Asphalt dieses, schon zuvor von mir abspazierten
Boulevards ist aufgerissen, die Straße in ihrem erbärmlichen
Zustand viel zu breit, und man kann förmlich ahnen,
wie die Hitzewellen der nächsten Jahre das Pflaster
noch mehr aufspringen lassen werden und die Natur sich
in die Ruinen der Modernität zurückfressen wird.
Ich
biege in eine Seitengasse ab und bin bald im Zentrum von
Tulear angelangt. Das Wechseln
in der Bank dauert unendlich
lange und verstärkt meinen Eindruck, dass im
Süden von Madagaskar alles noch länger dauert,
dass die Mühlen der Bürokratie noch träger
und langsamer mahlen als im nördlicheren Hochland.
Architektonisch
ist an Tulear kein Mittelpunkt festzustellen, außer
vielleicht der kleine schattige, von Bäumen
gesäumte Platz vor der Bank BNI-Crédit Lyonnais. Hier
finden sich die Leute ein, um sich zu treffen, der Szenerie
haftet ein
Hauch einer süditalienischen Piazza an.
Die Gebäude ringsumher in kolonialem Stil mit kleinen
Geschäften in den Arkaden sind aber
hilflos dem Staub der Straße und deren Ziellosigkeit
ausgeliefert. Ruhe einflößend
nur die Frauen an den Nähmaschinen, an Säulen
gelehnt sitzen sie im Schatten, bunte Stoffe über
ihren Beinen, darüber im Mittelpunkt auf einem kleinen
Tischlein die alte, englische Nähmaschine.
Das eigentliche Herz Tulears ist dessen Markt und das
bunte Treiben, das rund um ihn herrscht. Wenn man weiß wie
trocken dieser Landesteil über weite Teile des Jahres
ist, überrascht es umso mehr, wie vielfältig
das Angebot auf dem Markt ist. Nicht nur Bananen, Orangen
und
Maniok, wie überall im Hochland, sondern auch Ananas,
Papaya, Goaven, bis hin zu Avocados und so landwirtschaftlichen
Klassikern wie Salat, Tomaten und Radieschen finde ich
hier. Zum ersten Mal nach Tana.
Der
Menschenschlag hier unterscheidet sich deutlich vom südostasiatischen
Einschlag des Hochlands. Südostafrikanischer Einfluss
ist unverkennbar und auch vom Temperament sind die Menschen
lauter
und bunter als im zentralen Landesteil.
Zurück
in unserem Quartier, bei „Chez Alain“ erleben
wir den Auftritt einer lautstarken, tanzenden Folklore-Gruppe
mit Trommeln, Speeren und ähnlichem, vor allem mit der
hier weit verbreiteten Fidel Lokanga. Allesamt haben sie
ihr bestes Hemd angezogen, nämlich keines. Die Nacht ist
aufgrund gröhlender
Betrunkener und stundenlang bellender Hunde sowie krähender
Hähne
nicht besonders erholsam.
Am
nächsten Tag besuchen wir das Musée Maritime.
Es dauert einige Zeit, bis wir es finden. Nachdem wir im
Sperrgebiet der Raffinerie herumgeirrt sind und nur das
Gebäude des „Fischministeriums“ (Ministère
de Poisson) gefunden haben, bedarf es einiger Fragerei,
bis wir schließlich vor der Université Maritime
stehen und ein freundlich lächelnder Herr jenes Gebäude
aufsperrt, vor dem das riesige Skelett eines Wals thront.
Scheinbar sind Besucher selten. Mit zurückhaltender
Begeisterung führt uns der Mann durch die Räumlichkeiten,
an denen sich ein morsches Regal an das andere reiht, allesamt
mit der Last hunderter Einmachgläser. Diese sind mit
allen Fischen, Schalentieren, Muscheln, Seesternen, Seegurken
und allen anderen Meerestieren angefüllt, die vor den
Küsten Madagaskars zu finden sind. Oder besser gesagt
waren. Denn das Museum wurde Anfang der 60er-Jahre gegründet
und wurde seither wohl auch nicht mehr erneuert. So haben
viele der Fische seit 35 und mehr Jahren ihr Schicksal im
Formaldehyd gefunden, und die Rexgläser sind nicht immer
dicht. S. wagt einmal, eines mit einem Fisch mit tödlichem
Gift anzugreifen, und riecht noch Stunden später bestialisch
nach Fisch. Auch Waschen hilft nichts. Der Höhepunkt
des Museums ist sicherlich der erst 1938 vor der Nordküste
entdeckte Quastenflosser. Dieser hat sich seit 360 Millionen
Jahren nicht verändert, die Evolution ging spurlos an
ihm vorüber. So hat er immer noch vier Flossen und eine
beschuppte Haut, die an Reptilien erinnert. Da er auch neben
den Kiemen über zwei Lungen verfügt, gilt er als
einer der Vorfahren jener Reptilienfamilie, die vom Wasser
aufs Land ging und aus deren weiterer Entwicklung der
Mensch hervorging.
Darben
in Ifaty
Ifaty,
der Ort, der uns von allen möglichen Menschen
angepriesen wurde und dessen Besuch Glück, Heimat
und Heil verhieß, ist unser nächstes Ziel. Es
sei hier gleich gesagt, nichts von alledem ist in Ifaty
zu finden.
Schon die Anreise ist eine Tortur. Ein Lkw wird mithilfe
einiger Sitzbänke zu einem Taxi-Brousse umgewandelt,
dieser schaukelt uns die knapp 25 Kilometer mit zahlreichen
Zwischenstopps in über zwei Stunden ans Ziel. Nicht
nur, dass es eng und unbequem ist, wollen die überaus
unfreundlichen Fahrgäste auch keinen Zentimeter Platz
machen. Zudem besteht die Strecke aus wilder Sandpiste,
wo wohl Generationen von Wanderdünen wahre Wettläufe
bestritten haben mussten. Als wird dann das Zentrum
von Ifaty erreichen, können wir kaum glauben,
hier richtig zu sein. In uns war die Vorstellung eines
klassischen Badeorts gewesen, aber was wir vorfinden, sind
in der Mittagshitze
vor sich hin darbende Menschen in Armut, um nicht von Elend
zu sprechen.
Schließlich
gehen wir an den Strand, das Meer ruht in Ebbe vor uns,
und wir lassen uns im Halbschatten
einiger Kokospalmen nieder. Nach einiger Zeit bricht kilometerweit
vor uns das Meer immer stärker an ein Riff, das erst
zu einer anderen Jahreszeit zum Tauchen geeignet ist. Je
näher die Flut an die Küste kommt, umso mehr Fischer
kehren an den Strand zurück, bringen ihre Einbäume,
teilweise mit Segeln besetzt, und die Fänge des Tages
ans Ufer. Wenig später kommen zwei kleine Mädchen
zu uns, beide wohl kaum älter als acht Jahre und wollen
uns unbedingt Muschelketten verkaufen. Wir sind von diesen
wenig begeistert und sagen, wir seien zu arm, um sie zu
kaufen. Natürlich glauben sie uns nicht und unterhalten
sich bestens an unseren Ausreden, z. B. dass wir
jetzt von Moçambique hergeschwommen seien und so lange
unter der Kokospalme warteten, bis eine Nuss heruntergefallen
komme, die wir sie essen könnten. Nach und nach
fassen
sie immer mehr Vertrauen, berühren und umarmen uns
und sind dann, obwohl wir nichts gekauft haben,
doch ein wenig traurig, als wir gehen.
|